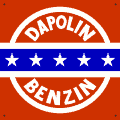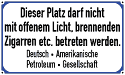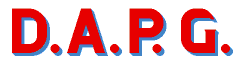Modellbahn: Gebäude und Hochbauten
Eine kleine Tankstelle
Unter der Art.-Nr. 330 983
bietet oder bot Pola G (Vertrieb Faller®)
eine Diesel–Kleintankstelle von Fremde Seite
Shell als Bausatz im Maßstab 1:22,5 an.
Auf einer Grundfläche von nur 17,8 × 12,3 cm
ist ein Kessel aufgestellt, der von einer hölzernen Dachkonstruktion mit Wellblech–Bedeckung
vor den Unbilden der Witterung geschützt wird. Die Zapfsäule vor der einen Kesselstirnwand ist
eine Ausführung von Shell (dazu gleich mehr). Eine Beschriftungs– oder Lackierungs–Variante wird nicht angeboten.
Dafür liegen dem wetterfesten Kunststoff–Bausatz etliche nette, kleine Ausstattungs–Details bei.
Die u.v.P. für den Bausatz
betrug 2010 rund 53,- € (Stand 2010). Aktuell ist das Modell nicht lieferbar (2012).
Hier wird kurz beschrieben, warum es zu einem fast vollständigen Neubau kam und wie der erfolgte.
Das soll keine Abwertung des Original–Bausatzes sein. Der Umbauvorschlag wendet sich an Modellbahner mit gehobenen Ansprüchen.
Abschnitte dieser Seite:
Der Pola–Bausatz
Die Teile des attraktiven Bausatzes entsprechen der gewohnten Pola–Qualität. Das heißt,
sie sind stabil und auf der Ober– und Unterseite der Spritzlinge gut detailliert, nicht jedoch
an den quer zur Trennebene liegenden Kanten. Dort sind beispielsweise die Holzbalken
beidseitig konisch, haben eine glatte Oberfläche und eine deutlich sichtbare Trennnaht.
Die Beschriftung für die runde Scheibe auf der Zapfsäule und deren Türen besteht
aus Kunststoff–Klebeetiketten, die sich der Bastler selbst ausschneiden muss.
Die Bauanleitung beschränkt sich auf ein Faltblatt mit einer Übersicht der Teile und
einigen Explosionszeichnungen, ist jedoch verständlich und frei von Fehlern. Ein paar
Hinweise dazu, wie die Teile der Dachkonstruktion am besten rechtwinklig zu verkleben
sind, hätten nichts geschadet. Da die massive Grundplatte nämlich keinerlei
Rastnasen oder Vertiefungen für die senkrechten Balken aufweist, müssen die vier
Bauteile freischwebend verbunden werden. Das ist für weniger geübte Modellbauer keine ganz leichte Aufgabe.
Das Wellblech–Dach ist ordentlich nachgebildet, sogar mit Imitationen der Befestigungs–Schrauben.
Lediglich die zu dicken Enden an den Stirnseiten vermögen nicht so recht zu überzeugen.
In der Mitte oben ist ein „zylindrisches Etwas”, von dem nicht ganz klar wird, was es darstellen soll - einen Lüfter vielleicht?
Mit dem gewählten Shell–Logo schränkt Pola den möglichen
Einsatz–Zeitraum stark ein. Diese Version der Muschel wurde nämlich nur zwischen 1961 und
1971 verwendet. Um 1900 war es noch eine schwarze Venusmuschel. Die Löwen– beuiehungsweise Kammmuschel–Form wurde
1904 eingeführt. Der Schriftzug Shell in der Muschel
kam erst 1948, die schwarze Farbe von Konturen und Schriftzug wurde 1961 durch rot ersetzt.
Die hier geplante Eisenbahn soll zur Zeit der Deutschen Reichsbahn–Gesellschaft
(1924 bis 1937) angesiedelt sein. Da die schwarze Muschel ohne Schriftzug aber nicht so
attraktiv ist, wurde beschlossen, die Tankstelle zu einer der DAPG
(Deutsch–Amerikanische Petroleum–Gesellschaft, Sitz Hamburg) zu machen. Das war die
Vorläuferin der späteren Standard Oil oder kurz ESSO. Außerdem wurde der Dieselkraftstoff im Tank durch Benzin ersetzt
.
Im vorletzten Abschnitt der Seite finden Sie einen Hinweis auf die dafür nötigen Druckdaten,
die auch zum Download angeboten werden (Registrierung erforderlich).
Baubeschreibung
Nach einigen Überlegungen wurde beschlossen, die gesamte Hütte samt Dach aus Holz und
Polystyrol neu zu bauen. Die Holzteile wirken am Besten, wenn sie aus Holz sind. Das
Dach sollte dünner und auch innen gewellt sein - und weniger ebenmäßig.
Die neue Unterbau–Platte besteht aus 10 mm
starkem Sperrholz. Über eine rechteckige Aussparung darin wurde der eigentliche Sockel
des Gebäudes (ebenfalls Holz) geklebt und mit Randsteinen versehen. Diese entstanden aus gegossenen Gips–Stangen.
Die Balkenkonstruktionen für die Seitenteile enstanden liegend aus Kiefernholz–Leisten.
Achtung: Beizen Sie vorgefertigte Einzelteile vor dem Kleben, da die
Beize an den Klebestellen nicht mehr wirkt. Zum Einsatz kam
Clou® 2530 „Nußbaum dunkel”.
Nach der Montage folgte einer Versiegelung der Holzteile mit mattem Klarlack.
Die Verschalungen an der Stirnseite und die Bretter an der Rückwand sind aufgeklebte Leistchen von
5 mm Breite, die Balken sind 6 × 6 mm stark.
Für eine stabile Verbindung zwischen Grundplatte und Aufbau sorgen vier selbstschneidende
Schrauben, die durch die Platte senkrecht in die Eckpfosten greifen (wichtig: Löcher vorbohren, sonst sprengt die Schraube die Leiste).
An der Rückseite der Überdachung wurde noch ein kleiner Schuppen angebaut, dessen
Tür hinten links sich dank kleiner Messing–Scharniere aus Rohr, Blech und Draht öffnen
lässt. In dem Schuppen steht ein selbst gebauter Kleinkompressor, außerdem gibt es
dort eine kleine Werkbank, Regale für Öldosen und Werkzeug sowie eine Lampe.
Der Kessel ruht - anders als beim Pola–Bausatz - auf hölzernen Stützen. Er wurde
Aluminium–farben gespritzt. Achten Sie nach der Montage und vor der Lackierung auf einen
guten Anschliff mit feinem Schleifpapier, denn Lacke halten nicht gut auf der unveränderten Oberfläche.
Die Montage der Zapfsäule selbst ist nicht weiter problematisch. Es gibt jedoch zwei
Schwachstellen. Die eine betrifft den Bausatz–Aufkleber für die Messuhr: Dessen Zahlen
sind putziger Weise spiegelverkehrt gedruckt. Ein Ausdruck aus dem Tintenstrahl–Drucker
auf Glossy–Papier behebt das Problem. Das Papierchen muss nach
dem Aufkleben mit hochglänzendem Klarlack versiegelt werden, damit es wetterfest wird.
Der senkrecht stehende Schriftzug „Dapolin” (Großbuchstaben) wurde nach der
Lackierung mit weißen Abreibebuchstaben auf den Klappen der Zapfsäule angebracht. Auch
diese Teile - wie die ganze Säule - wurden anschließend hochglänzend klar lackiert.
Die zweite Schwachstelle ist die Halterung für die runde Werbescheibe auf der Zapfsäule.
Sie ist extrem labil. Wer sich das zutraut, sollte ein 0,5 mm–Loch
in Scheibe und Säulendach bohren und die Verbindung mit einem Stückchen Stahldraht stabilisieren.
Bau des Dachs
Der Eigenbau des Wellblechdachs stellte sich als schwierig heraus. Das Basis–Material aus
Polystyrol stammt aus dem Architektur–Bedarf und ist fast maßstäblich dünn - und
dem entsprechend labberig. Außerdem sind die „Well–Plaste” natürlich nicht leicht quer zu biegen.
Nach einigen Überlegungen wurde dann der richtige Trick gefunden. Zunächst muss ein
gewölbter oder gleich zylindrischer Körper gefunden oder gebaut werden, der etwa dem gewünschten Innendurchmesser des Dachs entspricht.
Dann wird an der Rückseite der Körpers parallel zu Mittelachse eine Stange oder Holzleiste
angelegt. Auf die Vorderseite kommt die mit viel Zugabe an allen Seiten zurecht geschnittene
Dachplatte. Diese wird dann mit Nähgarn oder dünnem Bindfaden an jeder zweiten oder dritten Vertiefung auf die Wölbung geschnürt.
Dann muss die Konstruktion mit dem Heißluftgebläse oder Fön erwärmt werden, bis sich das Polystyrol
bleibend verformt hat. Dazu genügen etwa 60 bis 70° Celsius.
Nach dem Erkalten werden die Fäden abgewickelt und das Dach in die endgültige Form
geschnitten. Die Seitenränder neigen dazu, sich zu wellen, und die Stirnseiten dazu,
sich auf zu wölben. Daher der große, vorgesehene Beschnittrand. Wie auf den Fotos
zu erkennen ist, hat das Biegen auf der rechten Seite nicht ganz perfekt geklappt.
Das Dach kann nun grundiert, lackiert und aufgeklebt werden. Die Nachbildung der Halteschrauben
kann mit dünnen Messingstiften in Bohrungen erfolgen. Achtung: Schneiden Sie die benötigte Länge
vorher passend. In den Vertiefungen des Well–Plastiks können die Stifte nicht mehr abgezwackt werden.
Ausstattung und Zubehör
Wenn Ihnen die Tankstellen–Ausführung Standard Oil gefällt -
hier kommt die gute Nachricht: Sie müssen Schriftzüge und Werbeschild nicht neu
zeichnen. Bei den Downloads
wird ein Zip–Archiv mit allen benötigten Grafiken und Maßangaben für den Druck sowie einer
ausführlichen Anleitung angeboten. Die Bilder sind Rastergrafiken,
die problemlos auf einem handelsüblichen Tintenstrahldrucker ausgegeben werden können. Was wir Ihnen
nicht zum Download anbieten können, sind die weißen
Abreibe–Buchstaben mit 1,7 bis 2 mm Höhe. Da müssen Sie sich schon in ein Zeichen–Fachgeschäft bemühen.
Der Bau der Straßenlampe vor der Tankstelle wird auf einer eigenen Seite im Zubehör–Bereich
erklärt. Das gilt auch für das Werkzeug, das griffbereit rechts auf dem unteren Querbalken liegt.
Hier sei noch beschrieben, wie der Putzlumpen auf dem linken Querbalken gebastelt
wurde. Er entstand aus einem sorgfältig ausgeschnittenen Stück des glatten Bereichs eines
Papier–Taschentuchs (ohne Prägungen). Dann wurde der Lappen mit stark verdünnter
Schmutzfarbe getränkt (Humbrol® oder
Revell®) und auf der Kante eines anderen
Holzstückchens mit der Pinzette in Form drapiert. Nach der Trocknung wurde das nun recht
feste Teilchen mit ganz wenig Sekundenkleber auf den Balken der Tankstelle geklebt.
Die Öldosen im Schuppen entstanden aus abgelängten Stücken Polystyrol–Rundmaterial.
Der Kleinkompressor wurde - da ohnehin kaum sichtbar - aus Holzteilen zusammen geklebt.
Zwei Bilder des Schuppens
Dem Modell fehlen noch allerlei Verwitterungs–Spuren. Die können jedoch auch später
nachgetragen werden. Die runde Scheibe auf der Zapfsäule ist unterdes tatsächlich
abgebrochen. Das ist ein bisschen unglücklich, weil durch das überstehende Dach kein
Loch für einen neuen Stift mehr in den Säulendeckel gebohrt werden kann.
Zum Schluss dieses Beitrags folgen noch zwei Bilder des kleinen Schuppenanbaus an der Rückwand der Tankstelle.