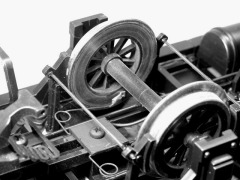Toytrain®–Wagen
Der Personenwagen
Auf dieser Seite wird der Umbau eines Toytrain–Reisezugwagens
im Maßstab 1:22,5 beschrieben.
Hinweis: LGB und Toytrain sind eingetragene
Warenzeichen des ehemaligen Patentwerks Ernst Paul Lehmann / von Märklin.
Das Modell ist für solche Zwecke gar nicht so schlecht geeignet. Das liegt vor allem
daran, dass den Innenraum längs nur auf drei beidseitige Sitzbank–Paare aufgeteilt wird.
Beim normalen Standard–Personenwagen von LGB sind das vier -
was für drangvolle Enge und blaue Flecken an den Knien der Preiser–Figuren sorgt
.
Das Wägelchen auf dem Einheitsfahrgestell hat ab Werk nur an einem Wagenende eine
Bühne. Wird gleichzeitig ein Güterwagen umgebaut, kann der Reisezugwagen mit zwei Bühnen versehen werden. Wie das geht, wird hier beschrieben.
Tipps: Toytrain–Waggonmodelle
werden bei eBay oft günstig angeboten. Lesen Sie auch die Seite
zum Thema Achslagerung und Drehgestelle. Dort finden Sie
viele auch auf Toytrain–Fahrwerke anwendbare Hinweise.
Abschnitte dieser Seite:
Das Fahrwerk
Auf der Seite zum Thema Toytrain–Güterwagen
wurde beschrieben, wie sich die asymmetrischen Fahrgestelle der Wagen trennen und neu zusammen setzen
lassen. Für diesen Wagen benötigen Sie nun die jeweils „längeren” Teile, also die, bei
denen der Abstand von der Achsmitte mit zur Pufferbohle länger ist als bei der anderen.
Damit ist es leider nicht getan. Damit die neuen Teile unter den Wagenkasten passen, muss
zwischen den Schnittstellen ein 19 mm langes
Rahmen–Füllstück angebracht werden. Das wurde hier aus Polystyrol gebastelt. Es ist auf dem Großbild links der Wagenmitte zu erkennen.
Auch hier wurden an den Einachs– Drehgestellen wieder Deichseln angebracht, die zur Wagenmitte
hin zeigen. Diese werden über eine Zugfeder verbunden. Das sorgt bei geschobenen Wagen für
eine automatische Geradstellung der Achsen und führt zu einem angemessenen Lenkverhalten bei zu engen Gleisbögen.
Die Bauteile für eine analoge Konstant–Beleuchtung
konnten alle am Fahrwerk versteckt werden. Die beiden Ein– und Ausgangs–Elkos (Elektrolyt–Kondensatoren)
wurden im Bremszylinder und Hilfsluft–Behälter versteckt.
Die Metallräder erhielten eine Stromabnahme über unauffällige Draht–Schleifer.
Tipps dazu finden Sie bei Stromabnahme und –leitungen.
Die im zweiten Bild gezeigte Ausführung neigt leider zum Quietschen, vor allem, wenn sich das Rad entgegen dem Schleifer dreht.
Das muss noch besser gelöst werden.
Der Aufbau
Beim Original–Modell sind rechts und links der Eingangs–Tür an der Bühne kleine, senkrechte Fenster. Die Tür ist nicht beweglich.
Die Stirnwände wurden also flugs heraus getrennt und duch Eigenbauten aus
3 mm starkem Polystyrol ersetzt, in das außen neue
Bretterfugen graviert wurden. Die neuen
Schiebetüren wurden aus 1,5 mm dicken Stücken gebaut,
mit einem Fensterchen versehen (natürlich verglast) und in U–Profilen verschiebbar gelagert.
Da es beim Kauf eines originalen Toytrain–Wagens nur ein Bühnengeländer
und nur ein Paar Dachstützen gibt, wurden diese Teile eben neu gebaut. Das Geländer enstand aus
1,3 mm starkem Rundmaterial mit einem oben quer liegenden
Profilaus Messingblech (0,8 mm. Die Dachstützen wurden
hingegen aus Polystyrol angefertigt. Die ebenfalls fehlenden Laufbretter für die Bühne wurden aus
1,5 mm–Polystyrol gebaut.
Die ab Werk weiß umrahmten Fenster wirken - abgesehen von der fehlenden Verglasung - arg groß.
Außerdem gibt es keine Fensterrahmen. Also wurde in die Hände gespuckt und ein Satz neuer
Fensterrahmen aus Polystyrol angefertigt, die passend in die Öffnungen geklebt wurden.
Sie erhielten bei der Endmontage hinterklebte Scheiben aus einem Kunststoff–Material (Vivak®).
Vorsicht beim Einsatz von Sekundenklebern! Diese können beim Abbinden häßliche weiße Schlieren
auf den Scheiben ergeben, die sich nicht mehr entfernen lassen. Da hilft der alte Trick mit einem
Tröpfchen Klebstoff, dass auf einem Draht aufgenommen wird und dank der Kapillar–Wirkung
pfeilschnell in die Zwischenräume fließt. Das funktioniert nur mit dünnflüssigen Klebstoffen.
Alternativ dazu bietet sich die Verwendung von UHU®–Alleskleber
an (die Ausführung mit Lösungsmitteln). Da lassen sich Fehler leicht mit
Link zum Glossar
Aceton ausbügeln, das in der Apotheke erhältlich ist.
Innenraum und Farbgebung
Wenn schon einige Sorgfalt auf den Aufbau verwendet wird, sollte der Fahrgast–Raum auch
ein wenig Liebe erfahren. Die Preiser–Figuren auf dem Foto waren
fast teurer als das Basis–Modell. Sie wurden mit einem
Montage–Kleber auf den nachlackierten Sitzbänken befestigt.
Die Wände des Innenraums erhielten mit dem Pinsel eine hellgraue Farbe, das Dach (siehe nächster Abschnitt) wurde innen weiß lackiert.
Fahrwerk und Aufbau wurden zunächst schwarz gespritzt, und zwar ganz trivial mit einer Sprühdose.
des Aufbaus erhielten ihren grünen Ton anschließend Die „Bretter” mit dem Pinsel und
Revell® Nr. 48 als Farbe.
Auf dem Foto ist unter einer der unbesetzten Sitzbänke ein aufgeklebtes Plättchen zu sehen.
Das wurde nötig, weil sonst der eine Kondensator der Beleuchtungs–Elektronik nicht in den
Bremszylinder gepasst hätte. Also musste an der richtigen Stelle der Fahrzeugboden durchbrochen werden, um noch etwas Höhe zu gewinnen.
Die Beschriftung enstand mit zwei Techniken.
Die kleinen technischen Anschriften wurden mit Abreibebuchstaben aufgebracht. Die Schilder für
„2. Klasse” sowie „Raucher” wurden hingegen auf dem Tintenstrahl–Drucker erzeugt und dann aufgeklebt.
Das gilt auch für das Reichsbahn–Emblem und die Wagennummern und Direktion, der der Wagen angehörte („81052” und
darunter „Kassel”).
Die Holzbretter der Trittstufen und der Bühnen wurden grau abgesetzt.
Zum Schluss erfolgte ein Überzug mit mattem Klarlack aus der Sprühdose (natürlich
vor dem Einsetzen der Fensterscheiben und Figuren).
Das Dach
Grübel, grübel - da war doch noch was? Ach ja: Dem Dach fehlt noch ein Segment für die zweite Bühne!
Das Foto in diesem Abschnitt zeigt zwar nicht den Toytrain–Wagen,
sondern ein umgebautes LGB–Modell. Dennoch wird aber die Wirkung von innen
hell lackierten Dächern und einer guten Beleuchtung deutlich.
Zurück zum fehlenden Dachstück über der neuen Bühne. Das entstand aus
3 mm–Polystyrol, in das unten zunächst passend
die Bretterfugen eingraviert wurden. Oben wurden ebenfalls zahlreiche Fugen eingeritzt, allerdings mit
weniger Sorgfalt. Die Oberseite wurde nämlich später mit Schleifpapier beklebt, das in der Körnung zu
der des originalen Dachteils passt. Die Fugen dienen lediglich dazu, dass sich das Ansatzstück leicht biegen lässt.
Das Stück wurde dann an die glatt gefeilte Kante des Dachs angeklebt und mit dem abgenudelten Schmirgelpapier als Dachhaut versehen.
Dann galt es, die zwei Glühlampen einzusetzen. Sie wurden über dünne Messingdrähte
miteinander verbunden. Diese führen an beiden Seiten weiter bis zum Stirnwand-Übergang
des Dachteils und enden dort in kleinen Schleifer–Plättchen aus Neusilber.
Passende Gegenstücke am Wagenkasten sorgen dafür, dass das Dach ohne Lötarbeiten einfach
abgeclipst und wieder aufgesetzt werden kann. Diese sind auf dem Großbild aus dem letzten Abschnitt gut zu erkennen.
Als Lampenlüfter für die „Petroleum”–Laternen wurden die Kunststoff–Kappen
von Pinboard–Stiften verwendet. Von deren Nadel wurde einfach
der größte Teil abgezwickt - bis auf einen Rest in Stärke des Dachs.